Veröffentlicht am 30. Juli 2021
Status: akzeptiert
Eckdaten
3 Jahre (01.11.2023 – 31.10.2026)
Kooperationspartnerschaften im Hochschulbereich
2023-1-DE01-KA220-HED-0000154146
Projektpauschale 400.000,00 €
Partner
🇩🇪 University of Duisburg-Essen, Germany
Dr. Mustafa Bilgin (coordinator)
🇫🇮 University of Jyväskylä, Finland
Prof. Dr. Piia Näykki
🇮🇪 Foyle Internship Europe Limited, Ireland
Paul Murray
Áine Murray
🇱🇹 Vytautas Magnus University, Lithuania
Prof. Dr. Viktorija Čepukienė
Prof. Dr. Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė
🇪🇸 M&M Profuture Training, S.L., Spain
Montserrat Renedo
Monica Moreno
🇹🇷 Dumlupınar University, Türkiye
Prof. Dr. Oktay Şahbaz
Förderer
![]()
Gefördert vom
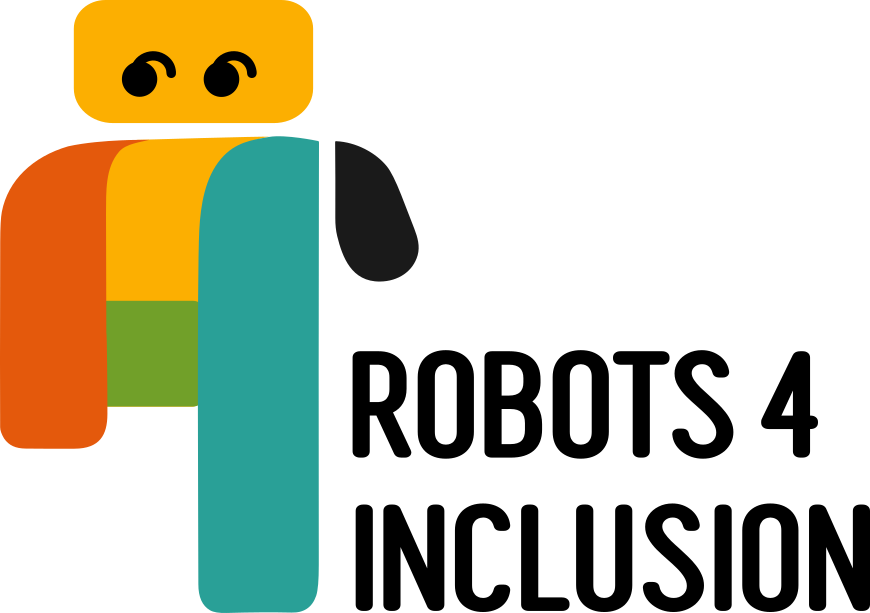
Robots4Inclusion
Bildungsrobotik zur Unterstützung
inklusiver Bildung an Grundschulen
Motivation
Die Verschmelzung von Inklusion und digitaler Kompetenzen werden in einer zunehmend digitalisierten Lebenswelt zu Schlüsselelementen unserer Zeit. Wir arbeiten eng mit unseren europäischen Partner:innen zusammen, um einen bedeutenden Beitrag zur inklusiven Bildung zu leisten. Unsere Aufmerksamkeit gilt insbesondere der Grundschulbildung, in der wir die soziale Partizipation und das Selbstkonzept von Kindern stärken wollen und darüber hinaus die Förderung informatischer sowie technischer Kompetenzen in den Vordergrund rücken möchten. Dadurch möchten wir junge Menschen auf die Herausforderungen einer zunehmend digitalisierten Welt vorbereiten.
Die Idee unseres Projekts ist die Einbindung von selbst gebauten Lernrobotern, in soziale Aktivitäten. Durch die Kombination von Technologie und sozialen Aktivitäten soll ein inklusiver Bildungsprozess gefördert werden, bei dem psychosoziale Kompetenzen eine zentrale Rolle spielen. Denn der Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule kann für viele Kinder eine große Herausforderung darstellen, da die bekannten Strukturen und Freundschaften teilweise aufgebrochen und in den weiterführenden Schulen erst einmal von Neuem entstehen müssen. Deshalb achten wir besonders auf die Stärkung des Selbstkonzepts und der Förderung psychosozialer Kompetenzen. Unser Projekt fokussiert sich ebenfalls auf Kompetenzen, die in der heutigen, vielleicht auch morgigen digitalen Welt von zentraler Bedeutung sind. Wir wollen voneinander lernen und unsere Ressourcen nutzen, um auf das Thema der Inklusion zu sensibilisieren und die Zukunftschancen aller Schüler: innen zu verbessern. Wir wollen mit unserem interdisziplinären EU-Projekt das gemeinsam erarbeitete Wissen nutzen und der Welt gemeinfrei (OER) zur Verfügung stellen, um damit eine nachhaltige Veränderung der Bildungslandschaften voranzutreiben.
Schlüsselwörter: Kind-Roboter-Interaktion, Inklusive Bildung, Educational Robotics, Teilhabe
Zusammenfassung
Die Regierungen vieler Länder haben sich 1994 durch die UNESCO in Salamanca, Spanien, und 2006 durch die UNCRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) am Sitz der Vereinten Nationen in New York verpflichtet, die inklusive Bildung voranzutreiben. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit unseren europäischen Partnern ein Projekt zu realisieren, das einen wichtigen Beitrag zur inklusiven Bildung leistet. Um die Inklusion und Vielfalt in der Grundschulbildung zu fördern, wollen wir die soziale Partizipation, die Teilhabe und das Selbstkonzept von Kindern stärken. Wir nehmen auch die Bewältigung des digitalen Wandels durch die Entwicklung digitaler Kompetenz an, indem wir die Selbstwirksamkeit junger Menschen steigern. Weiterhin möchten wir das Interesse an Wissenschaft, Technologie und Ingenieurwesen fördern. Im Hinblick auf das Zugehörigkeitsgefühl bezeichnet Köhler (2013) es als eine wichtige Kategorie der Inklusion und betont ihre Wichtigkeit in der Schule, wo die Qualität des Zusammenlebens bestimmt wird.
Eine Reihe von Untersuchungen zeigt, dass besonders Kinder mit Abweichungen im psychosozialen Bereich von sozialen Interaktionen ausgeschlossen und gemieden werden, da sie bspw. von ihren Peers für ein schlechtes Klassenklima verantwortlich gemacht werden (Krull et al. 2014). Kinder mit „Lernproblemen ließen sich [vergleichsweise] besser in ihre Klassen integrieren […]“ (Krull et al. 2014 S.172). Im Rahmen unseres Projektes konzentrieren wir uns auf die Stigmatisierung von marginalisierten Gruppen, wobei es unser Ziel ist, alle Kinder zu erreichen. Um die Bedürfnisse unserer Zielgruppe und der gesamten Schulgemeinschaft zu stärken, wollen wir einen ungewöhnlichen Ansatz wagen, indem wir die von den Kindern aufgebauten Lernroboter in eine soziale Intervention einbeziehen. Eine Kombination von technischen und sozialen Aktivitäten soll zu einem Inklusionsprozesses beitragen. In diesem Zusammenhang muss der „Erwerb psychosozialer Kompetenzen“ (Müller und Schumann 2021, S. 165) konkret definiert werden. „Kompetenzorientierung in inklusiven Kontexten bedeutet auch […], dass nicht nur die mit Lernprozessen im engeren Sinne verbundenen Fach-, Methoden- und sonstigen Kompetenzen berücksichtigt werden, sondern auch die Fähigkeiten des menschlichen Handelns ein wichtiges Thema werden.“ (Bezirksregierung Köln 2019, S. 25).
Diese Beziehung zwischen fachlichen und sozialen Aspekten wird von Müller und Schumann (2021, S 165), als integraler Bestandteil aller Schüler:innen in der Grundschule betrachtet. Es ist wichtig, sich der Gemeinschaft zugehörig zu fühlen und ein geschätzter, sozial eingebundener Teil dieser Gemeinschaft zu sein (Walton und Carr 2012). Auch der Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule stellt für alle Kinder eine herausfordernde Situation dar, da sich „die Bezugsgruppe und die sozialen Kontakte, das individuelle Selbstkonzept und die Selbsteinschätzung“ (Schaupp 2012, S. 196) in den weiterführenden Schulen verändern. Im Hinblick auf die Stabilität und Nachhaltigkeit der Persönlichkeit sind diese Ressourcen von großer Bedeutung. Auch die Bedeutung der digitalen Kompetenz, welche unsere Zielgruppen für den digitalen Wandel in ihrem Alltag und späteren Beruf benötigen, ist ebenfalls zu berücksichtigen. Wir als Projektpartner lernen voneinander und nutzen unsere Ressourcen, um unsere definierten Ziele zu erreichen.
Ein inklusiver Roboter namens TOKADI
 Die Fähigkeit, verschiedene Wahrnehmungen zu unterstützen, ist entscheidend für die Inklusion und ermöglicht es dem Kind, in einer Vielzahl von Umgebungen und Szenarien effektiv zu arbeiten. Die Unterstützung für auditive Wahrnehmung hilft den Kindern, Töne zu erkennen und zu deuten, während die kinästhetische Wahrnehmung es ermöglicht, Entfernungen und die Bewegung des inklusiven Roboters im Raum zu schätzen. Die selektive Wahrnehmung der Benutzeroberfläche und Bedienbarkeit und die individuelle Einstellbarkeit z.B. der Lautstärke (Sensitivität) ist besonders nützlich, um wichtige von unwichtigen Informationen zu unterscheiden, was in einer überstimulierenden Umgebung wichtig sein kann. Die taktile Wahrnehmung ermöglicht es dem Kind, durch Berührung zu lernen und zu navigieren, und die visuelle Wahrnehmung erlaubt ihm, Lichtinformationen (LED-Signale) zu verarbeiten und zu interpretieren.
Die Fähigkeit, verschiedene Wahrnehmungen zu unterstützen, ist entscheidend für die Inklusion und ermöglicht es dem Kind, in einer Vielzahl von Umgebungen und Szenarien effektiv zu arbeiten. Die Unterstützung für auditive Wahrnehmung hilft den Kindern, Töne zu erkennen und zu deuten, während die kinästhetische Wahrnehmung es ermöglicht, Entfernungen und die Bewegung des inklusiven Roboters im Raum zu schätzen. Die selektive Wahrnehmung der Benutzeroberfläche und Bedienbarkeit und die individuelle Einstellbarkeit z.B. der Lautstärke (Sensitivität) ist besonders nützlich, um wichtige von unwichtigen Informationen zu unterscheiden, was in einer überstimulierenden Umgebung wichtig sein kann. Die taktile Wahrnehmung ermöglicht es dem Kind, durch Berührung zu lernen und zu navigieren, und die visuelle Wahrnehmung erlaubt ihm, Lichtinformationen (LED-Signale) zu verarbeiten und zu interpretieren.

Zusätzlich kann die berührungslose auditive Klangsteuerung (Klatschen, Schnalzen, Pfeifen, Bodypercussion, Instrumente, wie Schlägel und Trommel, etc.) aktiviert werden, die auch Kinder mit Formen von Dysmelie oder Amelie unterstützen kann. Unser inklusiver Roboter kann eine große Hilfe für Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen sein und bietet Unterstützung, durch weitestgehende Barrierefreiheit.

Die Integration einer Schnittstelle, die sowohl auditive als auch visuelle Signale verwendet, ist eine weitere Methode, um die Interaktion mit dem Roboter zu erleichtern und zugänglicher zu machen. Die auditive Sequenz von Tönen, die eine Themenkarte repräsentiert, zusammen mit der gleichzeitigen Anzeige des entsprechenden Symbols auf einer 8·8-LED-Matrix, bietet eine klare und unmittelbare Rückmeldung für die Kinder, eine bestimmte Kategorie aus einer Reihe von Themenkarten zu wählen. Dies kann besonders nützlich sein für Menschen mit unterschiedlichen sensorischen Verarbeitungsweisen oder bestimmten Förderbedarfen. Die Auswahl einer Themenkarte ausgehend von der Sequenz an Tönen oder Symbolen kann dann spezifische Aktivitäten auslösen, wie unplugged Methoden, die spielerisch informatische Konzepte vermitteln, oder Aktivitäten, die die soziale und emotionale Entwicklung unterstützen. Dies zeigt, wie Technologie eingesetzt werden kann, um individuelle Lernprozesse und die Entwicklung von Schlüsselkompetenzen im Sinne einer Kind-Roboter-Interaktion zu unterstützen.
Nachhaltige Entwicklung
Im Rahmen der Entwicklung von TOKADI werden mehrere Nachhaltigkeitsziele (SDGs) der Vereinten Nationen berücksichtigt. Insbesondere wird das SDG 9 durch den effizienten Einsatz von Ressourcen in Kreisläufen und die Verwendung einzelner „sauberer Technologien” adressiert. Hierbei kommen insbesondere additive Fertigungsverfahren wie der 3D-Druck mit zwei Materialien (PLA und TPU) zum Einsatz. Der Roboter und seine Bauteile werden mittels dieser Fertigungsverfahren entwickelt, wobei weitestgehend auf Stützmaterialien verzichtet wird. Darüber hinaus wird das SDG 12 durch eine nachhaltige Produktion umgesetzt. Hierbei wird eine ökonomische und ökologische Effizienz bei der Entwicklung und Produktion angestrebt. Die additiv gefertigten Komponenten bestehen aus reinen Materialien, die vollständig recycelt und ohne Qualitätsverlust in neue Produkte umgewandelt werden können (Recyclingprozesse).
In der Entwicklung wird das Cradle-to-Cradle (C2C) Modell für eine effiziente und nachhaltige Kreislaufwirtschaft verfolgt. Unser Ziel ist es, unseren inklusiven Bildungsroboter TOKADI in einem kontinuierlichen Lebenszyklus zu halten. Dank der „Open Hard- und Software” von TOKADI kann dieser von Interessierten optimiert und individualisiert eingesetzt werden. Reparaturen und der Austausch defekter Teile folgen dem Konzept der „Weiterverwendung”.
Projektziele
Inklusion und Vielfalt in der Grundschulbildung fördern.
Bewältigung des digitalen Wandels durch die Entwicklung digitaler, informatischer und technischer Kompetenzen.
Förderung des Interesses und der Kompetenz in Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen.
Zielgruppe
Schüler:innen und Lehrkräfte.
Schwerpunkte
Technische Bildung; Informatische Bildung;
digitale Bildung; Inklusion;
Sonderpädagogische Förderung.
Studienart
Längsschnittstudie: Primarstufe (3. Klasse; Pre und Post Test + 4. Klasse Follow-up).
Mixed Methods Forschungsansatz
Fragestellungen
Text
Text
Text
Text
Soziale Medien
Quellenverzeichnis
UNESO 1994: (Externer Link)
UNCRPD 2016: (Externer Link)
Köhler 2014: (Externer Link)
Benitti 2012: (Externer Link)
Krull et al. 2014: (Externer Link)
Kohrt et al. 2021: (Externer Link)
Crede et al. 2019: (Externer Link)
Bezirksregierung Köln 2019: (Externer Link)
Müller und Schumann 2021: (Externer Link)
Walton und Carr 2012: (Externer Link)
Schaupp 2012: (Externer Link)
